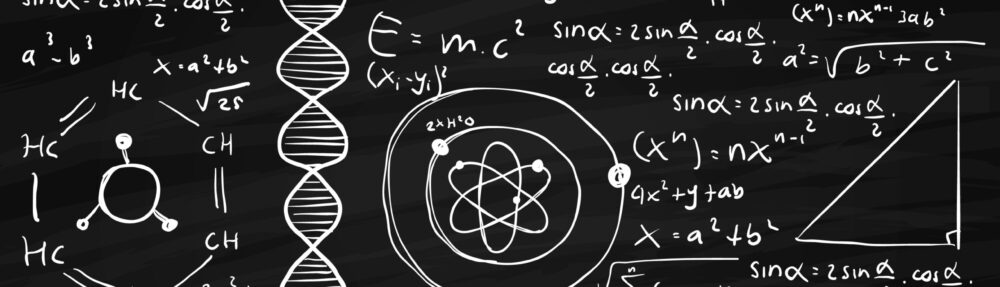Wir haben inzwischen ein Gefühl für Zustände, Messungen, Operatoren, Interferenz, Dekohärenz und Dynamik entwickelt. Jetzt bauen wir daraus ein Arbeitsgerät: Quanteninformation. Das Ziel dieses Teils ist klar: Aus physikalischen Grundideen werden Bausteine, aus Bausteinen werden Schaltungen, aus Schaltungen werden Algorithmen – und dann schauen wir ehrlich auf Rauschen und Fehlerkorrektur. Schritt für Schritt, immer mit der Brücke zwischen Formel, Bild und realem Labor.
1) Qubit: die kleinste Informationseinheit mit Phase
Ein Qubit ist ein Zweiniveau-System, dessen allgemeiner reiner Zustand geschrieben wird als
|ψ⟩ = α|0⟩ + β|1⟩, mit |α|² + |β|² = 1.
Die komplexen Amplituden α und β sind mehr als „Gewichte“ – ihre relative Phase trägt Interferenz. Auf der Bloch-Kugel ist jeder reine Zustand ein Punkt auf der Oberfläche; Nordpol ist |0⟩, Südpol |1⟩. Rotationen der Kugel entsprechen unitären Operationen am Qubit – physikalisch z. B. Mikrowellenpulse, Laser, oder optische Phasenplatten.
Einordnung zur Messung
Eine Messung in der Z-Basis („0/1“) liefert „0“ mit Wahrscheinlichkeit |α|² und „1“ mit |β|². Drehst du vor der Messung mit einem Hadamard H in die X-Basis, fragst du stattdessen „+ oder −?“ – dieselbe Realität, andere Fragestellung.
2) Elementare 1-Qubit-Gatter
Gatter sind kleine, fest definierte unitäre Operationen. Die wichtigsten im Standardbaukasten:
- Pauli:
X, Y, Zentsprechen 180°-Drehungen um x, y, z der Bloch-Kugel.X = [[0,1],[1,0]], Y = [[0,−i],[i,0]], Z = [[1,0],[0,−1]]
- Hadamard H: Basiswechsel zwischen Z- und X-Basis, erzeugt und löscht Superpositionen:
H = (1/√2) [[1, 1],[1, −1]]
Wirkung:
H|0⟩ = (|0⟩+|1⟩)/√2 = |+⟩,H|1⟩ = (|0⟩−|1⟩)/√2 = |−⟩. - Phasen-Gatter:
S = diag(1,i),T = diag(1,e^{iπ/4}). Sie drehen um die Z-Achse; zusammen mitHund einem 2-Qubit-Gatter erhältst du Universalität. - Rotationen:
R_x(θ) = e^{−i θ σ_x/2}, analogR_y, R_z. In Plattformen sind das die „Knöpfe“, die wirklich gedreht werden.
3) 2-Qubit-Gatter und Verschränkung
Verschränkung ist ein Ressourcenbegriff: Ohne sie wären Quantenalgorithmen nur „komische Zufallsmaschinen“. Das Standardgatter ist CNOT (kontrolliertes X):
CNOT |c,t⟩ = |c, t ⊕ c⟩.
Mit einem Hadamard auf dem Kontrollqubit erzeugst du eine Bell-Superposition:
|00⟩ --H⊗I--> (|00⟩ + |10⟩)/√2 --CNOT--> (|00⟩ + |11⟩)/√2 = |Φ⁺⟩.
Weitere 2-Qubit-Gatter: kontrollierte Phasen CP(φ), CZ, SWAP. Universell (für die ganze Unitärgruppe) ist z. B. das Set {H, T, CNOT}.
4) Das Schaltbild-Modell – wie man „Quantenprogramme“ liest
Ein Quantenschaltbild hat Zeilen (Qubits) und Bausteine (Gatter) von links nach rechts. Die Reihenfolge ist kritisch: Gatter kommutieren im Allgemeinen nicht. Messsymbole am Ende geben klassisches Bit-Ergebnis. Ein paar Miniprogramme:
- Interferenztest:
|0⟩ —H—H—Measure(Z). Ergebnis: immer „0“. Der ersteHbaut Superposition, der zweite löscht sie konstruktiv. Dazwischen ein PhasengatterR_z(φ)führt zu einercos²(φ/2)-Kurve der „0“-Häufigkeiten. - Bell-Erzeugung:
|00⟩ —H⊗I—CNOT—messbar verschränkt. - Superdense Coding / Teleportation: Gleiche Bauklötze, anderes Arrangement – die Macht liegt im Versetzen von
H,CNOT,Z/Xund Messungen.
5) Drei Einstiegsalgorithmen: vom Aha-Effekt zur Beschleunigung
5.1 Deutsch–Jozsa (strukturelle Entscheidung in einem Durchlauf)
Gegeben eine Blackbox-Funktion f:{0,1}^n→{0,1}, die entweder konstant oder balanciert ist. Klassisch braucht man im ungünstigsten Fall viele Abfragen; quantum reicht ein Durchlauf.
- Bereite
|0⟩^{⊗ n}|1⟩, lege auf alleH. - Wende die Oracle-Operation
U_f: |x,y⟩→|x, y⊕f(x)⟩an. - Lege wieder
Hauf die erstennQubits und messe.
Ergebnis: „alle Nullen“ → f war konstant; sonst balanciert. Hinter dem Trick steckt Phasen-„Buchhaltung“: Die globalen Muster in f werden in Interferenz übersetzt.
5.2 Bernstein–Vazirani (versteckter Bitstring in einem Durchlauf)
Es gibt einen geheimen String s∈{0,1}^n und f_s(x)=s·x (mod 2). Das gleiche Setup wie oben liefert nach einem Durchlauf direkt s. Kernidee: Das Oracle prägt eine Phase (−1)^{s·x} ein, die die nachfolgenden Hadamards wieder „auslesen“.
5.3 Grover-Suche (quadratische Beschleunigung)
Wir suchen ein markiertes Element unter N=2^n Optionen. Klassisch im Mittel O(N), quantum O(√N) Abfragen.
- Starte in der gleichverteilten Superposition
|ψ₀⟩ = H^{⊗ n}|0…0⟩. - Oracle spiegelt die markierten Zustände an der Phasenachse:
|w⟩→−|w⟩. - Diffusion spiegelt an der Mittellinie:
D = 2|ψ₀⟩⟨ψ₀| − 𝟙. - Wiederhole Oracle+Diffusion etwa
k ≈ ⌊(π/4)√N⌋Mal; die Erfolgswahrscheinlichkeit steigt nahe 1.
Anschaulich ist Grover eine Rotation in einer 2D-Ebene, die von dem markierten Zustand und dem Restspan aufgespannt wird. Jedes „Grover-Pärchen“ dreht die Amplitude ein Stück in Richtung der Lösung.
6) Die Quanten-Fourier-Transformation (QFT)
Die QFT ist das lineare Herz vieler Algorithmen (Shor, Phasenschätzung, periodische Strukturen):
QFT_N : |x⟩ → (1/√N) ∑_{k=0}^{N−1} e^{2πi xk/N} |k⟩, N=2^n.
Sie zerfällt in eine Kaskade aus Hadamards und kontrollierten Phasen R_k = diag(1, e^{iπ/2^{k−1}}) plus Bitumkehr. Gate-Kosten O(n²). Warum sie wirkt: Periodische Muster im Zeit-/Index-Raum werden in scharfe Peaks im „Frequenz“-Register übersetzt.
Phasenschätzung (PEA) in einem Satz
Gegeben eine Unitär U und einen Eigenzustand |ψ⟩ mit U|ψ⟩ = e^{2πiθ}|ψ⟩. PEA kopiert Information über θ in ein Hilfsregister via kontrollierte U^{2^k}-Anwendungen und liest mit einer QFT aus. Rechentrick: Viele „kleine“ kontrollierte Anwendungen statt einer „großen“ direkten Messung.
7) Rauschen in echten Geräten: T₁, T₂ und Gate-Fehler
Kein Labor ist perfekt. Drei Praxisgrößen begegnen dir immer:
- T₁ (Relaxation): Zeit, in der ein angeregter Zustand ins Grundniveau „auskühlt“.
- T₂ (Dephasierung): Zeit, in der Phaseninformation verloren geht (ohne Energieverlust).
- Gatterfehler: Abweichung eines realen Pulses von der idealen Unitär (Amplitude, Timing, Kalibrierung).
Ein Algorithmus mit Tiefe/„Laufzeit“ muss innerhalb der Kohärenzfenster liegen oder durch Fehlerkorrektur stabilisiert werden. Das ist der praktische Gegenpol zur schönen Theorie.
8) Erste Fehlerkorrektur: Bit-Flip, Phase-Flip, Shor & Steane
Quantenfehlerkorrektur (QEC) ist das Kunststück, ohne den Informationsgehalt zu messen dennoch Fehlerindikatoren (Syndrome) zu gewinnen und zu korrigieren. Kernprinzip: Redundanz in größerem Code-Raum, Messung von kommutierenden Stabilizern, Rückführung per Korrekturoperation.
8.1 Bit-Flip-Code (3-Qubit)
Schütze gegen X-Fehler, indem du logisches |0_L⟩=|000⟩, |1_L⟩=|111⟩ nimmst. Stabilizer: Z₁Z₂ und Z₂Z₃. Syndrom liest aus, welches einzelne Qubit geflippt wurde, danach korrigiere mit X an der Stelle. Analog der Phase-Flip-Code (gegen Z) entsteht, wenn du vorher in die X-Basis „wechselst“ (H-Gatter).
8.2 Shor-Code (9-Qubit)
Kombiniert Bit- und Phase-Schutz: Zuerst dreifach codieren, dann jede der drei Gruppen nochmals phasen-kodieren. Er korrigiert beliebige Ein-Qubit-Fehler, weil jede Pauli-Störung als Kombination aus X/Z betrachtet werden kann.
8.3 Steane-Code (7-Qubit)
Ein CSS-Code mit eleganter Struktur, der aus klassischen Hamming-Codes abgeleitet ist. Vorteile: effizientere Syndrome, schöne Transversalitätseigenschaften (manche logische Gatter wirken qubitweise ohne Fehlerverschmierung).
Stabilizer-Sprache (kompakt)
Ein Code wird als Menge kommutierender Operatoren {S_i} beschrieben, die den Code-Unterraum fixieren: gültige Zustände erfüllen S_i|ψ⟩=|ψ⟩ für alle i. Ein Fehler E ändert Vorzeichen einzelner S_i – das Muster der Vorzeichen ist das Syndrom. Korrektur heißt: Finde ein E', das die Syndrome zurücksetzt, ohne die logische Information zu zerstören.
9) Fault-Tolerance in einem Satz und der Surface-Code
„Fehlerfrei rechnen mit fehlerhaften Bausteinen“ wird möglich, wenn die physische Fehlerrate unter einer Schwelle liegt und man genügend Redundanz nutzt. In vielen Plattformen ist der Surface-Code der Arbeitspferd-Kandidat: Qubits liegen auf einem 2D-Gitter, Stabilizer sind lokale „Plaquettes“ (Z-Checks) und „Sterne“ (X-Checks). Vorteile: nur Nachbar-Interaktionen, relativ hohe Fehlerschwellen. Bild im Kopf: Ein Fischnetz aus Paritätsmessungen fängt einzelne Fehler, bevor sie zu Rissen werden.
10) Dynamische Fehlerunterdrückung: wenn Korrigieren zu teuer ist
- Spin-Echo / CPMG: Sequenzen aus π-Pulsen, die langsam drehende Phasenfehler rückwärts „spulen“.
- Komposit-Pulse (BB1, CORPSE): Statt eines riskanten großen Drehers eine Folge kleinerer Rotationen, die Kalibrierfehler ausmitteln.
- Randomized Compiling: Zufalls-Paulis um Gatter, um kohärente Fehler in harmloseres Rauschen zu verwandeln.
Das Ziel ist immer dasselbe: Interferenz bewahren, Rauschen in „leichter korrigierbare“ Formen pressen.
11) Plattformen im Überblick – wie die Theorie auf Metall, Ionen und Licht trifft
- Supraleitende Qubits: Mikrowellenkreise bei mK-Temperaturen; schnelle Gatter (ns–μs), viele Leitungen, Surface-Code-freundlich.
- Gefangene Ionen: Qubits in elektronischen Zuständen, gekoppelt über gemeinsame Schwingungen; sehr kohärent, Gatter etwas langsamer, hohe Einzellesequalität.
- Neutrale Atome / Rydberg: Viele Qubits in optischen Gittern, Blockade-Effekte erlauben Mehrkörper-Gatter; Skalierungsfantasie groß.
- Photonik: Qubits in Pfad/Polarisation/Zeitscheiben; gut für Kommunikation und Bosonensampling, Korrektur via Detektoren und nichtlinearen Tricks.
- Festkörper-Spins (NV-Zentren, Quantenpunkte): Kombination aus Optik und Mikrowellen, teils bei Raumtemperatur, gut für Sensorik.
Jede Plattform hat ihre „natürlichen“ Gatter und Fehlerkanäle – deswegen sehen Schaltbilder in echten Experimenten je nach Hardware etwas unterschiedlich aus.
12) Ein durchgerechneter Mini-Workflow: Superdichte Codierung
Ziel: Zwei klassische Bits mit einem einzigen Quantenbit übertragen. Zutaten: ein geteiltes Bell-Paar, lokale Operationen, eine Messung.
- Ressource: Erzeuge
|Φ⁺⟩ = (|00⟩+|11⟩)/√2. Ein Qubit bei Alice, eins bei Bob. - Kodierung: Abhängig von den zwei Bits
b₁b₂wendet Alice eines von{I, X, Z, XZ}auf ihr Qubit an. Tabelle:00 → I, 01 → X, 10 → Z, 11 → XZ.
Diese vier Operationen mappen
|Φ⁺⟩auf vier orthogonale Bell-Zustände. - Übertragung: Alice schickt ein Qubit (ihr part) zu Bob.
- Dekodierung: Bob führt eine Bell-Messung durch, z. B. mittels
CNOT(Alice→Bob) undHauf dem ersten Qubit, dann Messung in Z. Die zwei Messergebnisse sind genaub₁b₂.
Physikalisches Fazit dieses Workflows: Verschränkung ist ein Kanalbooster; ohne sie wäre pro Qubit auch nur ein klassisches Bit übertragbar.
13) Variations-Algorithmen: wenn volle Fehlerkorrektur (noch) fehlt
Auf heutiger Hardware nutzt man gern Variations-Ansätze (VQA). Idee: Eine parametrische Schaltung U(θ) mit wenigen, gut kalibrierbaren Rotationen; ein Kostenfunktional E(θ)=⟨ψ(θ)|Ĥ|ψ(θ)⟩; ein klassischer Optimierer, der θ nach Messungen anpasst. Beispiele:
- VQE (Energie-Minimum): Finde Grundzustände von Molekülen oder Modellen.
- QAOA (Kombinatorik): Abwechseln aus „Mischung“ und „Kosten-Phasen“, Tiefe als Qualitätshebel.
Warum dieser Weg anschaulich passt: Du drehst buchstäblich Knöpfe auf der Bloch-Kugel, misst, wie „gut“ der Zustand ist, und drehst weiter – ein sichtbarer Regelkreis zwischen Physik und Optimierung.
14) Ressourcen und Grenzen: Tiefe, Breite, T-Zählung
In praktischen Entwürfen zählt man nicht nur Gatter, sondern T-Gatter (weil sie teuer in Fault-Toleranz sind), die Schaltungstiefe (zusammenhängende Zeit) und die Breite (Zahl der Qubits). Shor-ähnliche Algorithmen brauchen QFT-Bausteine und viele kontrollierte Operationen; Grover skaliert in der Zahl Oracle-Anwendungen. Diese Metriken entscheiden, ob ein Plan „innerhalb der Kohärenz“ liegt – oder Fehlerkorrektur verlangt.
15) „Handwärmer“: kleine Übungen, die Verständnis festigen
- Bloch-Koordinaten: Für
|ψ⟩ = cos(θ/2)|0⟩ + e^{iφ} sin(θ/2)|1⟩: Zeige⟨σ_x⟩ = sinθ cosφ,⟨σ_y⟩ = sinθ sinφ,⟨σ_z⟩ = cosθ. - Bell-Zustände erzeugen: Baue alle vier aus
|Φ⁺⟩mitXundZauf einem Qubit. Welche Operation liefert|Ψ⁻⟩? - Grover-Geometrie: Leite her, dass die Winkelzunahme pro Iteration
2θbeträgt, wennsinθ = 1/√N. - QFT-Zerlegung: Schreibe die 3-Qubit-QFT als Sequenz
Hund kontrollierterR_k. Welche ist die Bitumkehr am Ende? - Bit-Flip-Syndrome: Simuliere (gedanklich) einen Fehler
Xauf dem zweiten Qubit des 3-Qubit-Codes. Welche Werte messenZ₁Z₂undZ₂Z₃?
16) Intuition weiter schärfen: Phasen sind Buchhaltung
Wenn du einen Algorithmus entwirrst, stelle drei Fragen:
- Welche Basis ist „natürlich“ für das Problem (Z, X, Fourier-/QFT-Basis)?
- Wo wird Verschränkung erzeugt und wieder „geerntet“ (Gatter wie CNOT/CZ)?
- Wie wird Phase in ein Messsignal verwandelt (Hadamards, Interferenzkämme, PEA)?
Diese Mini-Checkliste macht Schaltungen lesbar. Du siehst dann Grover nicht als Mysterium, sondern als wiederholte, wohlgezielte Spiegelung an zwei Geraden im Zustandsraum.
17) Kleine Formelsammlung zum Mitnehmen
Hadamard: H = (1/√2) [[1,1],[1,−1]] Pauli: X = [[0,1],[1,0]], Y = [[0,−i],[i,0]], Z = [[1,0],[0,−1]] Rotation: R_n(θ) = e^{−i θ (n·σ)/2} CNOT: |c,t⟩ → |c, t⊕c⟩ Diffusion: D = 2|ψ₀⟩⟨ψ₀| − 𝟙, |ψ₀⟩=H^{⊗ n}|0…0⟩ QFT: |x⟩ → (1/√N) ∑_k e^{2πi xk/N} |k⟩ Phasenschätzung: kontrollierte U^{2^k} + QFT† → Bits von θ Bit-Flip-Code: |0_L⟩=|000⟩, |1_L⟩=|111⟩, Stabilizer: Z₁Z₂, Z₂Z₃ Stabilizer-Satz: S_i|ψ⟩=|ψ⟩, Syndrome = Vorzeichen der S_i
18) Mentale Bilder, die tragen
- Gatter als Drehungen: Du drehst Pfeile auf der Bloch-Kugel. Einfache Drehungen (Rx, Ry, Rz) und „Kopplungs-Drehungen“ (CNOT/CZ) reichen, um jede Musik zu spielen.
- Verschränkung als Klammer: Zwei Pfeile, die einzeln unbestimmt sind, aber gemeinsam einen klaren Takt halten – Information „sitzt in der Beziehung“.
- Fehler als Wind: Kleine Böen verschieben Winkel (Dephasierung) oder drücken Pfeile zum Pol (Relaxation). Echo-Sequenzen sind Windschatten, Codes sind Wetterschutz.
19) Woran man Reifepläne misst
Wenn du eine Idee bewertest („Können wir Problem X mit Quanten besser lösen?“), prüfe:
- Struktur: Gibt es Periodizität oder Phasenmuster, die QFT/PEA berühren?
- Oracle-Kosten: Lässt sich eine Zielbedingung als effiziente Phasendrehung kodieren (Grover-Stil)?
- Ressourcen: Qubit-Zahl, Tiefe, T-Zählung vs. T₁/T₂ und erwartbare Fehlerraten.
- Mitigation/Code: Reicht Dynamik-Unterdrückung, oder braucht es echten Code (Surface, Steane)?
20) Worauf wir als Nächstes aufsetzen
Jetzt stehen die Werkzeuge bereit: Qubits, Gatter, Verschränkung, QFT und Phasenschätzung, Grover-Rotation, Code-Syndrome und Stabilizer-Denken. Im nächsten Teil heben wir das auf universitäres Niveau, indem wir drei Brücken schlagen: (i) Hamilton-Simulation und Trotterisierung als allgemeine „Physik-Rechenmaschine“, (ii) präzise Fehlerschwellen und fault-tolerante Logik (inklusive magischer Zustände und T-Distillation), (iii) die Landkarte der Variations- und Digitalschemata für reale Materialien, Chemie und Optimierung – jeweils so, dass die nötigen Ressourcen und Kompromisse klar werden.
weiter?