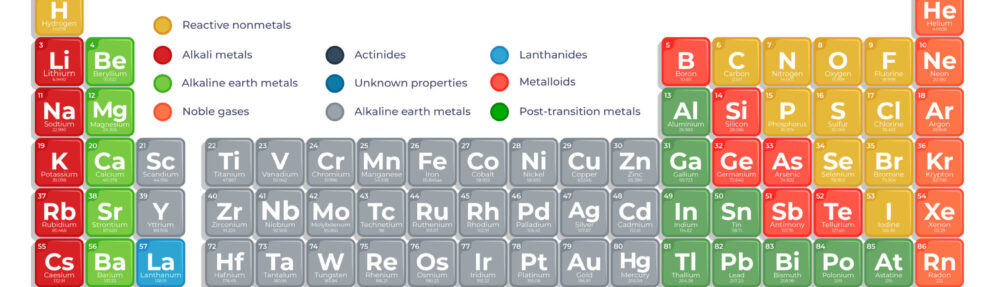Jetzt machen wir Quantenchemie wirklich praktisch. Wir gehen den ganzen Weg: vom Molekül – Geometrie, Basissatz, Integrale – zur zweiten Quantisierung, zum Qubit-Hamiltonian, zur Zustandsvorbereitung (HF, aktive Räume), zur Energieauswertung und Gradienten, bis hin zu Ressourcen- und Fehleranalysen. Ziel ist, dass du jede Zahl und jedes Gate im Arbeitsablauf fachlich erklären kannst und weißt, wo Genauigkeit, Tiefe und Messzeit herkommen.
1) Von Atomen zu Integralen: der chemische Input
Start ist eine Kerngeometrie {R_A, Z_A} (Kernpositionen und -ladungen) und ein Basissatz {χ_μ(r)} (typisch gaussförmig: STO-3G, 6-31G*, cc-pVxZ …). Aus diesen Funktionen berechnet man die Standardintegrale:
Overlap: S_{μν} = ∫ χ_μ(r) χ_ν(r) dr Kinetik: T_{μν} = −½ ∫ χ_μ(r) ∇² χ_ν(r) dr Kernanziehung: V_{μν} = ∑_A ∫ χ_μ(r) (−Z_A/|r−R_A|) χ_ν(r) dr Zweielektron: (μν|λσ) = ∫∫ χ_μ(r₁) χ_ν(r₁) (1/|r₁−r₂|) χ_λ(r₂) χ_σ(r₂) dr₁ dr₂
Im orthonormalisierten MO-Raum (später) werden daraus die Ein- und Zwei-Elektronen-Integrale h_{pq} und h_{pqrs}. Wichtig: Der Aufwand klassischer Integralberechnung dominiert nicht deine Quantenressourcen – er läuft vorgelagert auf der CPU und liefert die Zahlen, die in den Hamiltonian eingehen.
2) Hartree–Fock (HF): Referenz, Orbitale, Besetzung
HF liefert eine selbstkonsistente Näherung für Orbitale {φ_p} und deren Besetzung. Man löst die Roothaan–Hall-Gleichung
F C = S C ε
für die Koeffizientenmatrix C (MO aus AO), Eigenwerte ε (orbital energies). Der Fock-Operator ist
F_{μν} = h_{μν} + ∑_{λσ} D_{λσ} [ (μν|λσ) − ½ (μλ|νσ) ] ,
wobei h = T + V und D die Dichtematrix aus besetzten Orbitalen ist. Ergebnis: Ein Slater-Determinant |Φ_HF⟩ als Referenzzustand, Orbitale in „besetzt“ (O) und „virtuell“ (V) getrennt. Praktisch friert man oft Kernorbitale ein (freeze core), um Qubits zu sparen, ohne Chemie der Valenz stark zu verändern.
3) Zweite Quantisierung: Elektronenphysik als Operator-Algebra
Im MO-/Spinorbitalraum wird der Elektronen-Hamiltonoperator
Ĥ = ∑_{pq} h_{pq} a_p† a_q + ½ ∑_{pqrs} h_{pqrs} a_p† a_q† a_r a_s + E_{nn}.
a_p†/a_p sind Fermion-Erzeuger/Vernichter; E_{nn} ist die Kern–Kern-Abstoßung. Zählweise: Spinorbitale zählen (α/β pro räumliches Orbital). Die Zahl der Spinorbitale N_orb ist die minimale Qubitzahl, bevor wir symmetriebedingte Reduktionen nutzen.
4) Fermion→Qubit: Mapping und Symmetrie-Tapering
Am Qubit brauchen wir Paulis. Zwei gängige Abbildungen:
- Jordan–Wigner (JW): Lokale Besetzung ↔ lokales Z; Antisymmetrie via Z-Ketten:
a_p = (⊗_{j<p} Z_j) (X_p − i Y_p)/2. - Bravyi–Kitaev (BK): Paritäts- und Ortsinformation ausgewogen; kürzere mittlere Strings.
Symmetrien: Teilchenzahl Ň, Gesamt-Spin-Z-Komponente S_z (oder Paritäten) kommutieren mit Ĥ. In Parity-/BK-Mappings lassen sich oft 2 Z₂-Symmetrien „tapern“ (fixierte Eigenwerte), was zwei Qubits spart. Außerdem reduziert aktive-Raum-Wahl die Orbitalzahl. Beispiel: H₂ in STO-3G → 4 Spinorbitale → mit Symmetrie auf 2 Qubits.
5) Energieausdruck und Pauli-Zerlegung
Nach dem Mapping hat Ĥ die Form
Ĥ = ∑_j c_j P_j, P_j ∈ {I,X,Y,Z}^{⊗ n_Q}.
Die Energie ist E = ⟨ψ|Ĥ|ψ⟩ = ∑_j c_j ⟨P_j⟩. Man misst also Erwartungswerte vieler Pauli-Strings. Gruppierung: Qubit-weise kommutierende (QWC) oder allgemein kommutierende (GC) Strings zusammenfassen, um Basenwechsel zu minimieren; die Zahl der Messgruppen dominiert die Shot-Kosten.
6) Zustandsansätze: von schwach bis stark korreliert
- UCCSD (unitary coupled cluster singles/doubles):
|ψ(θ)⟩ = e^{T(θ) − T(θ)†} |Φ_HF⟩, mitT = ∑_{i∈O,a∈V} θ_i^a a_a† a_i + ¼ ∑_{ij∈O,ab∈V} θ_{ij}^{ab} a_a† a_b† a_j a_i. Erhält Teilchenzahl/Spin; gute Chemie-Treue bei moderater Korrelation. - k-UpCCGSD: Produkt weniger Generalized-Singles/Doubles-Exponenten; flach, hardwarefreundlich.
- ADAPT–VQE: Operator-Pool (z. B. alle einzeln-exzitationsartigen Paulis) → wähle iterativ den stärksten Gradienten, wachse den Ansatz adaptiv, bis der Energie-Gradient verschwindet.
- qEOM/VQE-EOM: Anregungsspektren über Gleichungen der Bewegung auf VQE-Grundzustand; misst kommutatorbasierte Matrizen.
- Multi-Referenz (aktive Räume): Für starke Korrelation (gestrecktes N₂, Übergangsmetalle) nutzt man CASSCF: wähle ein aktives Raum
(n_e, n_{orb}), bestimme Orbitale variational (klass.) und löse Elektronen-Korrelation im aktiven Raum (quantum) → qCASSCF (orbital optimization + VQE/FCI in der CAS).
7) Unitarisierung & Trotterisierung von UCC
Der Exponent e^{T−T†} wird als Produkt elementarer Exponenten umgesetzt (Trotter-Produktformel):
e^{∑_k κ_k G_k} ≈ ∏_k e^{κ_k G_k} (1. Ordnung),
wobei G_k Antihermitesche Generatoren (aus Paulis) sind. Ordnungs- und Kommutatorfehler sind Teil der Ansatz-Näherung; in der Praxis genügt oft 1–2 Trotter-Schichten.
8) Messen effizient: Low-Rank, DF und Cholesky
Der Zwei-Elektronenteil generiert nominal O(N_orb^4) Terme. Faktorisation senkt Kosten:
- Dichte-Fitting (DF)/Resolution of Identity: Approximiert
(pq|rs)≈∑_Q B_{pq}^Q B_{rs}^Qmit Hilfsbasis. Führt zuO(N^3)-Skalen in Anzahl der Pauli-Strings. - Cholesky-Faktorisation: Zerlegt den (pq|rs)-Tensor niedrig-rangig; ermöglicht Hamiltonian als Summe von Quadraten von 1-Elektron-Operatoren.
- Double-Factorization: Weiterer Rangabbau führt zu Schaltungen mit
O(N^2)parametrierten Rotationen für die Zeitentwicklung/PEA.
Für VQE senkt Low-Rank direkt die Messgruppen; für PEA/LCU senkt es die „1-Norm“ λ = ∑|α_k|, die die Tiefe bestimmt.
9) Geometrien, Kräfte, Energieflächen
Energieflächen (PES): Disktretisiere die Reaktionskoordinate (Bondlänge, Winkel), berechne E(R). „Chemische Genauigkeit“ ≈ 1 kcal/mol ≈ 1.6 mHa. Ein robuster Workflow ist VQE für Grobkurve + wenige PEA-Korrekturen an kritischen Punkten.
Gradienten: Für einen Parameter λ (z. B. Kernkoordinate) ist
∂E/∂λ = ⟨∂Ĥ/∂λ⟩ + 2 Re ⟨∂ψ/∂λ | (Ĥ − E) | ψ⟩.
Bei exakten Eigenzuständen (PEA) fällt der zweite Term weg (Hellmann–Feynman); bei VQE bleibt ein Pulay-Term. Praktisch: Messe reduzierte Dichtematrizen (1-RDM, 2-RDM) auf dem QC und berechne Gradienten klassisch (AO-Integrale liefern ∂h/∂λ, ∂(pq|rs)/∂λ). So gelingt Geometrieoptimierung/TS-Suche hybrid.
10) Fallstudien (kompakt, aber vollständig)
10.1 H₂, STO-3G: Lehrbuchkurve
- AO→MO, HF: besetze σ_g, virtuelle σ_u.
- Spinorbitale: 4 → nach Parität/Teilchenzahl auf 2 Qubits „getapert“.
- Ĥ = ∑ c_j P_j,
P_j ∈ {I,Z,XZ,ZX,XX}(kleine Handvoll Strings). - Ansatz: exact two-qubit ansatz (entspricht FCI im 2Q-Raum) oder UCCSD (hier identisch).
- Scan R(H–H) von 0.5–3.0 Å, ΔR=0.05–0.1 Å → E(R). Vergleich mit FCI (klassisch) macht Fehler sichtbar. Chemische Genauigkeit leicht erreichbar.
10.2 LiH, Minimalbasis: erstes „nichttriviales“ System
- Freeze core (Li 1s), aktiver Raum aus Valenzorbitalsatz (Li 2s, H 1s) → 6–8 Spinorbitale.
- Qubits: 6–8, Tapering spart 1–2. UCCSD/ADAPT-VQE, DF für Messreduktion.
- Messgruppen O(10²) statt O(10³–10⁴) durch QWC/GC-Grouping.
10.3 Wasser H₂O, Winkelbiegung
- Geometrie: fixiere OH-Längen, variiere ∠HOH. Aktiver Raum CAS(6e, 6o) deckt lone pairs + Bindungen ab.
- qCASSCF: Orbitale klassisch optimieren, CAS-Energie via VQE (ADAPT) → PES entlang des Winkels.
- Kleine PEA-Schritte an Minima/Übergängen sichern Nachkommastellen.
11) Schusszahlen, Varianzen, Stoppregeln
Energievarianz durch Summe von Varianzen der Pauli-Strings (und Kovarianzen zwischen gemeinsam gemessenen). Für einen Term P_j gilt Varianz ≤ 1; die Standardabweichung der Energie skaliert wie σ_E ~ √(∑ w_g Var_g / N_g) mit Gruppen-Gewichten w_g und Shots N_g. Adaptive Shot-Allocation: verteile Shots dort, wo |c_j| groß ist und die Varianz hoch.
12) Optimierer: stabil, robust, „chemie-tauglich“
Für VQE sind glatte, rauschtolerante Optimierer entscheidend: L-BFGS (mit Rauschdämpfung), COBYLA/Powell (derivatenfrei), SPSA (stochastisch mit wenigen Auswertungen), Bayes-Optimierung für grobe global Suche. Parameter-Shift gibt exakte Gradienten für Rotationen, aber verdoppelt Messaufwand pro Parameter – oft nur in später Feinschleife nutzen.
13) Fehlerquellen & -kontrolle (Chemie-spezifisch)
- Basissatzfehler: Kurven nähern sich mit größerer Basis der CBS-Grenze. Option: extrapoliere aus cc-pVDZ/cc-pVTZ.
- Aktiver Raum zu klein: Fehlende Korrelation → systematischer Off-Set. Diagnose via RDM-Indikatoren (z. B. natürliche Besetzungszahlen entfernt von 0/2).
- Ansatzfehler: UCCSD reicht nicht bei starker Korrelation; ADAPT oder Mehr-Referenz-Ansätze nehmen weitere Operatoren auf.
- Trotterfehler: Niedrige Trotter-Ordnung → Energie-Bias; reduziere durch Operator-Reordering/Mehretagen oder wähle direkt qubit-ansatzbasierte Generatoren (hardware-efficient & spin-/teilchenzahl-erhaltend).
- Messfehler: Readout-Mitigation via Kalibrier-Matrix, korrelierte Fehler über randomized compiling glätten.
14) Ressourcen grob abschätzen
- Qubits: = Spinorbitale im aktiven Raum − (Symmetrietaper). Typisch CAS(6,6) → 12 − 2 = 10 Qubits.
- Pauli-Terme: Naiv O(N⁴), mit DF/Cholesky effektive Gruppenzahl O(N²–N³).
- VQE-Tiefe: UCCSD-first order: Singles ~ O(|O||V|), Doubles ~ O(|O|²|V|²) exponentielle Faktoren; mit „commuting-excitation“ Reordering sinkt Tiefe stark.
- PEA/LCU: Tiefe ~ O(λ t) mit λ=∑|α_k|; Low-Rank senkt λ. Dafür braucht es fault tolerance (T-Counts), siehe Teil 6/7.
15) Mini-Workflows zum Nachrechnen (ohne Code, aber operabel)
- H₂ Kurve: Geometrie-Grid; HF; JW-Mapping; Tapering; 2Q-Ansatz; Messgruppen (2–3); Shot-Allokation bis σ_E < 0.5 mHa.
- LiH Bindung: Freeze core; aktive Orbitale wählen; DF-basiert Pauli-Zerlegung; UCCSD (1–2 Trotter); COBYLA → L-BFGS Feinschliff; Readout-Mitigation; Vergleich mit CCSD(T) (klassisch) als Referenz.
- qCASSCF Schritt: Initiale Orbitale; VQE im CAS; 1- und 2-RDM messen; klassische Orbitalrotationen optimieren (Pulay); iterieren bis ΔE < 1 mHa.
- Gradient an einem Punkt: Messe 1-/2-RDM; berechne ∂h/∂R, ∂(pq|rs)/∂R klassisch; bilde ∂E/∂R; Newton-Schritt auf PES.
- Low-Rank Check: Führe Cholesky auf (pq|rs) mit Schwellwert δ durch; vergleiche Energie mit/ohne Reduktion, wähle δ so, dass ΔE < 0.5 mHa bleibt.
16) Kompakte Formeln & Notizen
Elektronen-Hamiltonian: Ĥ = ∑_{pq} h_{pq} a_p† a_q + ½ ∑_{pqrs} h_{pqrs} a_p† a_q† a_r a_s + E_nn UCCSD-Generatoren: T₁ = ∑_{i,a} θ_i^a a_a† a_i, T₂ = ¼∑_{ij,ab} θ_{ij}^{ab} a_a† a_b† a_j a_i Pauli-Dekomposition: Ĥ = ∑_j c_j P_j, E = ∑_j c_j ⟨P_j⟩ DF/RI-Faktorisation: (pq|rs) ≈ ∑_Q B_{pq}^Q B_{rs}^Q Chemische Genauigkeit: 1 kcal/mol ≈ 1.593 mHa ≈ 0.043 eV Hellmann–Feynman: ∂E/∂λ = ⟨∂Ĥ/∂λ⟩ (für exakte Eigenzustände) Shot-Varianz (Gruppen): σ_E² ≈ ∑_g (w_g² Var_g / N_g), optimal N_g ∝ w_g √Var_g Tapering (Z₂): fixe Symmetrie-Eigenwerte → 1–2 Qubits weniger
17) Mentale Bilder, die Chemie & Quanten verbinden
- Basissatz als Farbkasten: Mehr Farben (größere Basis) malen feiner, kosten aber mehr Leinwand (Qubits).
- Aktiver Raum als Bühne: Auf der Hauptbühne spielen die elektronischen Dramen; Nebenrollen (Kern, tiefe Orbitale) bleiben im Off – sparen Qubits, ohne die Handlung zu verlieren.
- Faktorisation als Lego: Große Coulomb-Blöcke in kleine, wiederverwendbare Bausteine zerlegen – weniger Teile, gleiches Bild.
- VQE vs. PEA als Ohr vs. Stimmgerät: VQE stimmt nach Gehör, schnell und robust; PEA gibt die Frequenz auf 1–2 Nachkommastellen, braucht aber Ruhe (Kohärenz).
Mit diesem Werkzeugkasten kannst du reale chemische Aufgaben strukturieren: Geometrie → Integrale → HF → aktiver Raum → Mapping/Tapering → Ansatzwahl → Messgruppen & Shots → (optional) Gradienten. Du kannst abschätzen, wie viele Qubits und Messgruppen eine Zielgenauigkeit kosten, wann Low-Rank-Faktorisationen nötig sind, und wann ein qCASSCF-Loop den Unterschied macht. Im abschließenden Teil 9t gehen wir noch tiefer in die Theorie: Pfadintegrale, Vielteilchen-Methoden, topologische und effektive Feldtheorien – jeweils mit klarer Verbindung zur experimentellen Signatur und zur Implementierbarkeit auf Quantenhardware.